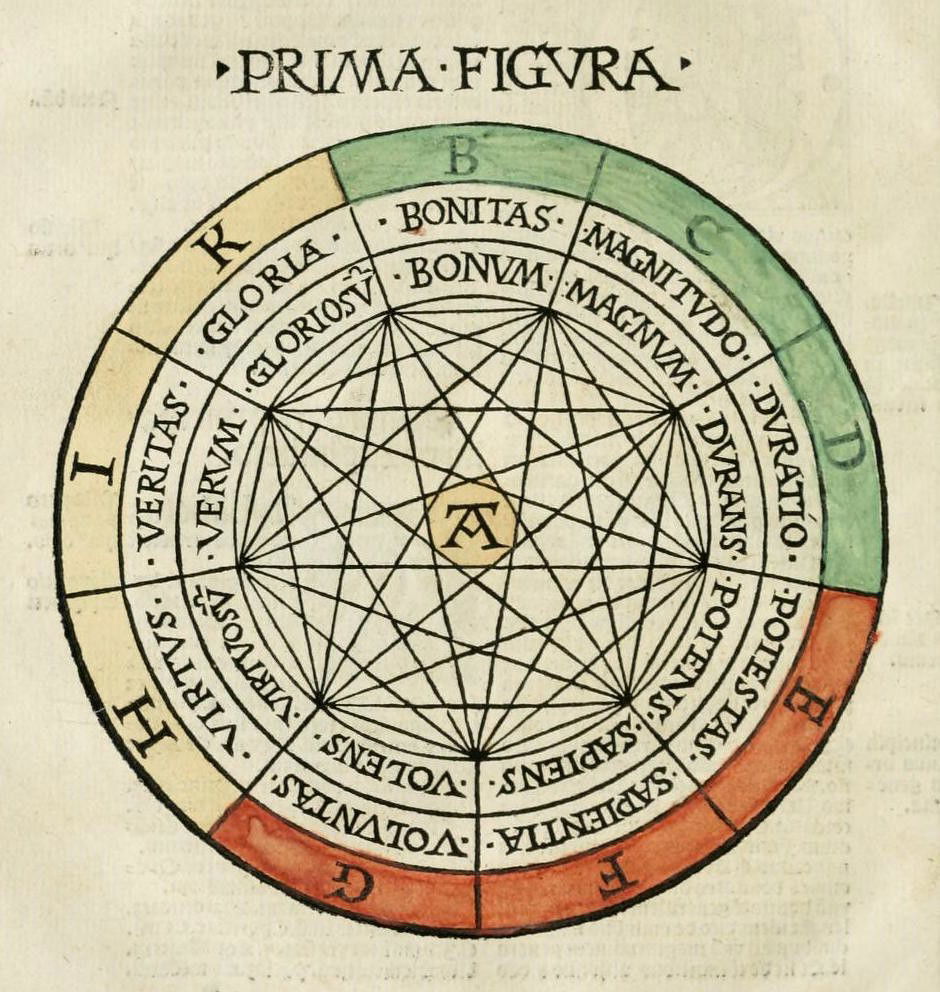Digitale Entwicklungen, Alltagskultur und politische Veränderungen bedingen sich gegenseitig. 2016 hat der Kultursoziologe Felix Stalder die Merkmale dieser Zusammenhänge in dem Sachbuch „Kultur der Digitalität“ untersucht. Ihm ist gelungen, Struktur und Dynamiken der Turing-Galaxis, der grundlegend neuen Medienlandschaft durch Vernetzung von Computern, mit ihren kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Folgen zu erklären.
Kurz
Felix Stalder entwickelt eine Analyse der aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen.
Strukturiert ist der Text durch drei Kapitel:
- Historische Entwicklung (Wege in die Digitalität)
- Kulturelle Entwicklungen verbreiten sich, mehr Menschen haben vielfältigere Angebote zur Verfügung
Eigenschaften der künftigen Kultur (Formen der Digitalität)
- Wie werden die kulturellen Praktiken genutzt (Referentialität, Gemeinschaftlichkeit, Algorithmizität)?
Adlige, Handwerker, reiche Bauern, Kleriker, Gelehrte: sie alle entdeckten durch den in der Mitte des 15. Jahrhunderts entwickelten Buchdruck neue Möglichkeiten, ihr Wissen über die Welt zu erweitern. Dieses erste Massenmedium ermöglichte ihnen Neues zu erfahren, das ihnen half, ihren Interessen gezielt nachzugehen. Die Gutenberg-Galaxis entstand.
Nach dem Buchdruck kamen später der Film, das Radio, das Fernsehen als weitere Massenmedien dazu, die einen erheblichen Wissenszuwachs ermöglichten.
Alle diese Medien waren weitgehend Einbahnstraßen: Informationen flossen von einer Quelle zu den Empfängern. Nur wenige konnten Produzenten und Verbreiter von Wissen sein.
- politische Dimension (Richtungen der Politischen in der Digitalität)
- Die Merkmale von Postdemokratie und Commons
Wege in die Digitalität
Der kulturelle Wandel in der Digitalität
Mit der rasanten Ausbreitung des World Wide Net ändert sich die Rolle der Teilnehmenden: Sie sind nicht nur Rezipienten, sondern auch Produzenten im Netz. Die alte Gutenberg-Galaxis, die Massenmedien als Einbahnstraße, wird abgelöst von der Turing-Galaxis , in der Millionen vernetzte Computer die Kommunikation zwischen Menschen und Institutionen verändern. Unser konkreter Alltag wird immer schneller umgestaltete. Unsere politischen und kulturellen Möglichkeiten der Information, der Äußerung von Meinungen und der Einflussnahme auf andere Menschen vervielfältigen sich.
Stalder untersucht vor allem zwei Aspekte des durch die digitalen Medien hervorgerufenen kulturellen Wandels:
Zum einen stellt er fest, dass durch die Vernetzung veränderte gesellschaftliche, kulturelle und politische Strukturen, neue Formen der digitalen Kultur entstehen.
Zum anderen beschreibt er, wie sich durch die digitale Vernetzung neue politische, gesellschaftliche und kulturelle Konsequenzen ergeben, die unsere Gesellschaften in Zukunft grundlegend bestimmen.
Formen der Digitalität
Stalder fasst unter dem Begriff der Digitalität stellt dar, wie neue Formen der Kultur durch Entwicklung digitaler Medien enstehen. Sie haben folgende Charakteristika:
Referentialität
Die Vielfalt digitaler Objekte (Texte, Bilder Filme, Töne,…) ist nur lose strukturiert und erzeugt Unübersichtlichkeit. Die Nutzenden sind gezwungen, durch Auswahl und Zusammenführen der in den digitalen Speichern (Datenbanken, Chats, Videoplattformen,…) enthaltenen Objekte neue Beziehungen herzustellen, wenn sie in der Vielfalt einen Bedeutung, einen Sinn entdecken wollen. Die neuen Verbindungen zwischen diesen digitalen Objekte und den Nutzenden führt zu einer Veränderung von Objekten (s.a. Photoshop oder aktuell generative KI)
Gemeinschaftlichkeit
Alte Institutionen wie Kirche, Parteien oder Gewerkschaften hielten eine sozial und kulturell klar definierte Struktur aufrecht. Durch die Vernetzung vieler Individuen in der Turing-Galaxis bilden sich neue soziale Organisationen heraus, die sich darüber definieren, dass sie gemeinsame Ziele und Interessen haben. Die sich so bildenden neuen Gruppierungen sind in ihrer Struktur informell und vielfältig, eine gemeinsame Basis haben sie in der genutzten Technologie des digitalen Kommunikation.
Algorithmizität
Automatisierte Entscheidungsverfahren bringen Übersichtlichkeit im Rauschen in den unermesslichen Datenmengen. z.B. Anzeige von Suchergebnissen oder auch KI. Die Folge ist eine Sichtweise, dass die Welt stringent nach logisch erkennbaren und begründbaren Prinzipien aufgebaut sei. Immer mehr bisher als kreativ menschliche definierte Fähigkeiten werden algorithmisch durchstrukturiert (KI). Die Grenzen von Logik und Kreativität verschwinden. Beispiele sind die Produkte von generativer KI und Bots in Sozialen Medien.
Auf Grundlage der fortgeschrittenen Algorithmen werden Prognosen über zukünftiges Verhalten erstellt.
Politische Konsequenzen
Die neuen Formen der digitalen Kultur haben politische Konsequenzen. Bei der Betrachtung dieser Konsequenzen sind zwei Ebenen zu betrachten: Einmal die Produktionskräfte, das heißt die technische Infrastruktur, das Wissen und die Arbeitsorganisation. Zum anderen die Produktionsverhältnisse, die den politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmen für die Herstellung von Produkten bilden. Ein Beispiel für diese Unterscheidung sind einerseits die digitalen Möglichkeiten, künstlerische Produkte zu erzeugen und andererseits das Urheberrecht, mit dem diese Produkte nicht mehr zu erfassen sind.
Die Dynamik zwischen Produktionskräften und Produktionsverhältnissen in ihrer Vielfalt ordnet Stalder dem Gegensatz von Common und Postdemokratie zu. Sie sind zwei politische Entwicklungslinien, die den Umgang mit digitalen Medien bestimmen und damit auch entscheidend sind für die Frage, wie Produkte der Digitalität demokratische Entwicklungen oder Hierarchien unterstützen.
Postdemokratie
Kennzeichnend für postdemokratische Strukturen ist die Entfernung der Menschen, der Bürgerinnen aus den politischen Entscheidungsprozessen. Technokratische Gruppierungen verwalten die politischen Prozesse unter der Maßgabe der Effizienz. E-Mail als ursprünglich allgemeiner und offener Dienst ist immer stärker in den Zugriff von Anbietern von Web-Mail geraten. Es entsteht ein Machtgefälle zwischen Inhabern der technischen Infrastruktur und den Nutzenden. Facebook ist dafür ein gutes Beispiel.
Neben der Strukturierung der Daten für die personalisierte Werbung spielt die Beeinflussung umfangreicher Nutzerinnengruppen eine wesentliche Rolle in den Vorgehensweisen der Anbieter. Angewandt wird ein Prinzip der Kybernetik, das besagt, dass leichte Änderungen der Umgebung, in unserem Fall die sozialen Medien, über Feedbackschleifen Änderungen im Verhalten der Zielpersonen bewirken. Dies schlägt sich auch im sogenannten Nudging nieder: die für das Individuum unmerkliche Gestaltung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umgebung ist bestimmend für die Entwicklungsrichtung großer Gruppen.
Durch die Monopolisierung der digitalen Netzwerke erhält eine kleine Gruppe Personen Macht über die Nutzerinnen sozialer Medien. Und ausweichen können Nutzerinnen nicht, da die Netzwerke abgeschlossen sind gegenüber anderen Netzwerken.
Neben diesen als private Beziehungen zwischen Menschen und wirtschaftlichen Institutionen gestalteten Strukturen geht Stalder auf die verdeckten und offenen Aktionen staatlicher Organisationen ein: Nicht nur werden Bürgerinnen überwacht, es wird versucht, auf die Einstellungen der Bürgerinnen direkt oder indirekt durch Steuerung von Informationskanälen Einfluss zu nehmen.
Bei allen diesen Anwendungsbereichen steht die Output-Legitimation im Vordergrund, also die Frage, ob das angestrebte Ziel (Profitmaximierung, Überwachung, Steuerung) erreicht wird. Die Input-Legitimation, also die Frage, ob die Änderungen der Rahmenbedingungen auch den Interessen der Betroffenen und der geltenden Rechtslage entsprechen, wird immer unbedeutender.
Die beschriebenen Entwicklungen in der Postdemokratie unterliegen einem Prozess der Normalisierung: Es scheint mittlerweile den meisten Menschen egal zu sein, dass sie ständig von privaten wie staatlichen Akteuren gelenkt werden.
Auf der anderen Seite gibt es gegen diese Machtzusammenballung immer mehr Widerstand: Leaking von Informationen und die diverse Gegenbewegung, die Offenheit und Einflussmöglichkeiten einfordern.
Commons
Es gibt nicht nur die Produktionsweise, die auf Unterordnung und Gewinnmaximierung zielen, sondern eine, die auf den Zusammenschluss von grundsätzlich Gleichen zur Erreichung eines vereinbarten Ziels basiert, den Commons.
Commons sind nichts grundsätzlich Neues, im Lauf der Geschichte und in unterschiedlichen Kulturen gab es immer verschiedene Formationen von Commons. Verschiedene Aspekte charakterisieren diese Commons:
Einmal die Nutzung von gemeinschaftlichen Ressourcen, zum anderen die Charaktere und Ziele der Mitglieder der gemeinschaftlichen Organisationen und drittens die von diesen Gemeinschaften gebildeten Regeln.
In Folge dieser Regeln steht bei den Commons die gemeinsame Praxis im Vordergrund, nicht die Ausrichtung an Gewinnen. Sie stehen in der Regel auch bürokratischen Regeln fern, die über hierarchische Anweisungsketten funktionieren.
Ziel ist, einen Konsens über Wege und Ziel des gemeinsamen Vorhabens in direktem sozialen Kontakt auszuhandeln. Die durch die technischen Entwicklungen digitaler Werkzeuge erweiterten Möglichkeiten der Kommunikation unterstützen diese Vorgehensweise.
Ein spezieller Bereich sind die informationellen Güter, in dem sich die Eigenheiten von Commons ablesen lassen: Freie Software und Freie Kultur. Die Konkretisierung des Aspekts der Freien Software zeigt Stalder in einer Beschreibung des Debian-Projekts, eines umfangreichen Projekts für die Entwicklung eines freien PC-Beriebssystems. Rechtliche Strukturen werden in diesem Bereich durch Lizenzregelung der Commons entwickelt.
Die Entwicklung freier Kultur wurde bestimmt durch die Auseinandersetzung um das Urheberrecht. Freie Lizenzen im kulturellen Bereich wurden durch die von der Organisation „Creative Commons“ etabliert.
Neben Freier Software und Freier Kulturprodukte sind Offene Daten ein weiterer Bereich, in dem sich Commons bilden. Ein Beispiel ist Open Street Map (OSM), die freie Kartensoftware. Die Möglichkeiten auf Daten zugreifen zu können ist konstituierend für Machtstrukturen. Freie Daten sind daher eine Möglichkeit, postdemokratischen Strukturen gemeinschaftliche Gegengewichte entgegen zu stellen. Freie Daten werden dadurch definiert, dass sie ohne Einschränkungen frei genutzt, weiter verbreitet und verwendet werden können. Häufig bilden sich Commons, die selbst Daten erheben und diese unter der Maßgabe der Prinzipien Offener Daten nutzen und weiter geben.
Zusammenfassung
Die bisher auf dem Buchdruck basierende „Gutenberg-Galaxis“ wird von der „Turing-Galaxis“ abgelöst, die eine auf digitalen Werkzeugen beruhende neue Kultur etabliert. Zwischen kulturellen Produkten und der Gesellschaft entstehen neue Beziehungen, die von algorithmischen Entscheidungen geprägt sind.
Die gesellschaftlichen und politischen Tendenzen verstärken den Gegensatz von Postdemokratie und Commons. Dieser Gegensatz zwischen antidemokratischen Einzelinteressen und gemeinschaftlicher Orientierung zieht sich durch die Menschheitsgeschichte.
Er bekommt aber aktuell eine besondere Bedeutung, weil die Besitzer der meisten digitalen Produktionsmittel, die Tech-Oligarchen, ihre autoritäre Ideologie viel umfangreicher durchsetzen können als in der Gutenberg-Galaxis. Die verwendeten aktuellen technischen Hilfsmittel sind meist Produkte auf Grundlage der Weiterentwicklung Neuronaler Netze. Gegen die Postdemokratie entwickelt sich aber eine sehr diversifizierte und vielfältige Kultur des Teilens. Offene, von allen verwendbare und überprüfbare digitale Objekte und Strukturen sind eine Ausdruck von Gemeinschaftlichkeit.
Für zukünftige Entwicklungen demokratischer Gesellschaften wird es besonders wichtig sein, ob sich die Kultur der Teilens in der Digitalität gegen profitorientierte, geschlossene Einzelinteressen bestehen kann.